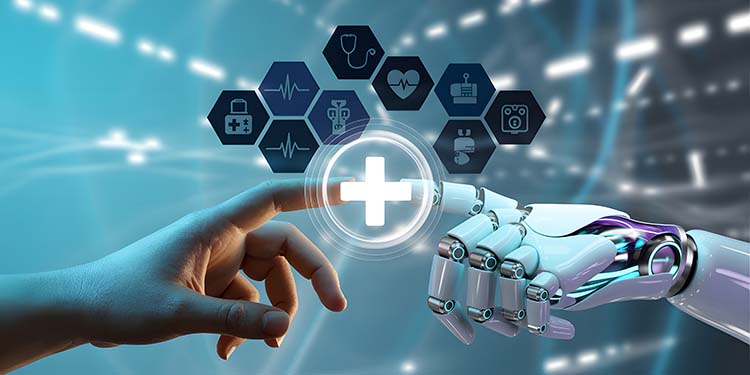Misteltherapie
Werbebeitrag/ Autorin: Anne Klein
Misteltherapie
Mistelextrakte, gewonnen aus dem weißen Mistelbusch (Viscum album L.), werden seit über 100 Jahren medizinisch verwendet. In der integrativen Krebstherapie gehören sie heute zu den häufig verordneten pflanzlichen Arzneimitteln und sind damit ein fester Bestandteil vieler onkologischer Behandlungskonzepte.
Die Mistel ist eine parasitisch wachsende Pflanze, deren Extrakte eine Vielzahl von biologisch aktiven Substanzen enthalten, darunter Pflanzen-Lectine, Viscotoxine, Polysaccharide und andere Komponenten. Nach anthroposophischem Ansatz sollen diese Substanzen immunmodulierende Effekte ausüben und so die körpereigenen Abwehrkräfte unterstützen. In der integrativen Onkologie wird die Misteltherapie daher nicht als Ersatz für konventionelle Krebsbehandlungen verstanden, sondern als ergänzende Maßnahme zur Verbesserung des allgemeinen Befindens während einer belastenden Therapiephase.
In der klinischen Praxis erfolgt die Misteltherapie in der Regel als subkutane Injektion, also als Spritze unter die Haut, meist mehrmals pro Woche über einen definierten Zeitraum. Die Therapie kann parallel zu Chemotherapie, Strahlentherapie oder nach Operationen eingesetzt werden, sofern sie vom behandelnden Onkologen oder einer spezialisierten Praxiseinrichtung verordnet wird. Die Ziele einer solchen integrativen Behandlung sind primär die Verbesserung der Lebensqualität, die Unterstützung des körperlichen und psychischen Gleichgewichts sowie die Linderung therapieassoziierter Beschwerden wie Erschöpfung, Appetitverlust und Schmerzen.
Studienlage
Die Misteltherapie gehört zu den am intensivsten untersuchten komplementären Verfahren in der Krebsmedizin. In der Fachliteratur existieren zahlreiche klinische Studien und Übersichtsarbeiten, die sich mit Effekten auf Lebensqualität, Verträglichkeit, mögliche Überlebensvorteile und Nebenwirkungen befassen. Eine systematische Analyse zeigt, dass viele Studien Hinweise auf eine Verbesserung der Lebensqualität und eine Verringerung von Nebenwirkungen im Rahmen einer Chemotherapie geben, wobei die methodische Qualität der Arbeiten unterschiedlich bewertet wird und nicht alle Ergebnisse eindeutig sind.
Die S3-Leitlinie Komplementärmedizin in der Onkologie benennt explizit, dass die subkutane Anwendung von Mistelpräparaten zur Verbesserung der Lebensqualität bei soliden Tumoren als eine optionale ergänzende Maßnahme angesehen werden kann (Evidenzniveau 1a). Zudem zeigte ein randomisiertes klinisches Studiendesign, dass Mistelextrakte während einer Chemotherapie sicher angewendet werden konnten und keine Zunahme von Fieber oder negativen Wechselwirkungen mit den Chemotherapeutika beobachtet wurden; in dieser Untersuchung wurde zudem eine Tendenz zu geringerer Neutropenie und verbesserten Werten für Schmerz und Appetitverlust festgestellt.
Andere Übersichtsstudien weisen darauf hin, dass die wissenschaftliche Datenlage hinsichtlich eines direkten Einflusses auf Tumorwachstum oder Überleben uneinheitlich ist. Einige Studien berichten von positiven Effekten, andere zeigen keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt gilt: Die Evidenz ist zwar umfangreich, aber nicht in allen Aspekten eindeutig oder methodisch stark genug, um eindeutige kausale Schlussfolgerungen zu ziehen.
Aus Sicht der Patienten
Aus Sicht vieler Patientinnen und Patienten kann eine integrative Misteltherapie zur subjektiven Verbesserung des Wohlbefindens beitragen. Qualitative Studien berichten, dass Patientinnen Effekte auf Vitalität, emotionale Stabilität und allgemeines Lebensgefühl beobachten. Solche persönlichen Wahrnehmungen sind wichtig für den ganzheitlichen Therapieansatz, sie sind aber nicht gleichzusetzen mit objektiven medizinischen Endpunkten wie Tumorverkleinerung oder Überlebenszeit.
Insgesamt wird die Misteltherapie in der onkologischen Begleitung im Allgemeinen gut vertragen. Häufige unerwünschte Reaktionen sind lokale Hautreaktionen an den Injektionsstellen wie Rötung, Juckreiz oder kleine Knötchen. Gelegentlich können grippeähnliche Beschwerden auftreten. Schwerere Nebenwirkungen sind selten, aber wie bei jedem biologischen Präparat möglich; sehr selten wurden Überempfindlichkeits- oder allergische Reaktionen beschrieben. Deshalb ist die Therapie nur unter ärztlicher Indikation und Aufsicht sinnvoll.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Die integrative Misteltherapie stellt eine etablierte, häufig genutzte komplementäre Maßnahme in der onkologischen Begleitung dar, die in Deutschland eine lange Tradition und eine umfangreiche Forschungsbasis besitzt. Sie wird vor allem eingesetzt, um Lebensqualität zu verbessern und Nebenwirkungen konventioneller Tumortherapien abzumildern. Entscheidungen für oder gegen eine Misteltherapie sollten stets individuell in enger Abstimmung mit den behandelnden Ärzten getroffen werden.