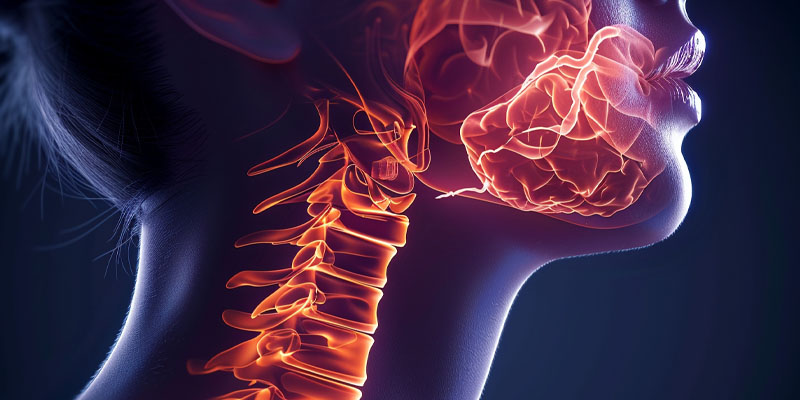Antibabypille
Autorin Anne Klein
Antibabypille
Kaum ein Medikament hat in den letzten Jahren für so viel Schlagzeilen bei Frauen gesorgt wie die Pille. Die Liste der Nebenwirkungen ist zwar lang, jedoch ist die Antibabypille eine der häufigsten verwendeten Methoden der Empfängnisverhütung, die Frauen eine hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität bietet. Die Antibabypille ist ein hormonelles Verhütungsmittel und dient dazu, eine Schwangerschaft zu verhindern. Die Tablette enthält synthetisch hergestellte Hormone wie Östrogen und/oder Gestagen, die das Heranreifen einer Eizelle im Eierstock und den Eisprung unterdrücken. Es gibt verschiedene Arten von Anti-Baby-Pillen, die meisten sind Kombinationspillen, sie enthalten eine Kombination aus den Hormonen Östrogen und Gestagen. Unterschieden werden:
Monophasige Pillen: Monophasige Anti-Baby-Pillen enthalten eine einheitliche Hormondosis während des gesamten Einnahmezyklus.
Mehrphasige Pillen: Mehrphasige Pillen haben unterschiedliche Hormondosierungen während des Einnahmezyklus. So wird der natürliche Hormonzyklus einer Frau nachgeahmt. Aufgrund der unterschiedlichen Dosierung müssen Sie im Gegensatz zu monophasigen Pillen bei mehrphasigen Pillen auf die richtige Reihenfolge bei der Einnahme achten.
Minipillen: In der Minipille sind nur Gestagene enthalten. Sie kann im Gegensatz zur Kombinationspille auch während der Stillzeit eingenommen werden.
Die Pille muss regelmäßig und korrekt eingenommen werden. Sie sollte jeden Tag um die gleiche Uhrzeit eingenommen werden. Bei Kombinationspräparaten erfolgt je nach Zusammensetzung nach 21 Tagen eine Einnahmepause von 7 Tagen. Dann setzt eine „Abbruchblutung” ein und Sie nehmen nach 7 Tagen wieder täglich die Pille weiter. Die Minipille wird täglich zur gleichen Zeit ohne Pause eingenommen.
Nebenwirkungen
Wie bei jedem Medikament sind auch bei der Pille Nebenwirkungen möglich. Manche Frauen leiden unter Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, depressiven Verstimmungen, sexueller Lustlosigkeit oder einem Spannungsgefühl in den Brüsten. Einige Beschwerden verschwinden von allein innerhalb der ersten drei Monate der Pilleneinnahme. Sind die Beschwerden sehr belastend oder treten sie über einen längeren Zeitraum auf, sollten Sie das Präparat wechseln. Wenn das nicht hilft, sollten Sie grundsätzlich über eine andere Verhütungsmethode nachdenken. Die Pille erhöht leicht das Risiko für Thrombosen, einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall und bestimmte Krebserkrankungen. Schwerwiegende gesundheitliche Probleme sind aber sehr selten. Zu den schwerwiegendsten möglichen, allerdings sehr seltenen, Komplikationen bei der Pilleneinnahme gehören Thrombosen und Lungenembolien. Nach einer Studie der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA ist das Risiko für Thrombosen und Lungenembolien bei einigen neuen Pillen der dritten und vierten Generation eineinhalb bis zweimal so groß wie bei den älteren Pillen.
Statistisch erkranken bei der Einnahme einer Pille aus der dritten und vierten Generation neun bis zwölf von 10.000 Frauen pro Jahr an Embolien, bei den Pillen der ersten und zweiten Generation sind es fünf bis sieben. Bei sechs bis sieben Millionen Frauen, die in Deutschland mit der Pille verhüten, sind statistisch jedes Jahr mehrere Tausend Frauen von gefährlichen Thrombosen und Embolien betroffen. Im Vergleich dazu erkranken von 10.000 Frauen, die nicht die Pille einnehmen, jährlich nur zwei. Eine Thrombose entsteht, wenn sich ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß bildet und es verstopft. In den allermeisten Fällen geschieht dies in den Bein- und Beckenvenen. Eine Thrombose kann gefährlich werden, wenn sich das Blutgerinnsel löst, durch den Körper wandert und in der Lunge ein Blutgefäß verstopft. Es kommt zur Lungenembolie, bildet sich ein Blutgerinnsel im Gehirn und verschließt es ein Gefäß, führt dies zu einem Schlaganfall.
Andere Risiken
Das Risiko für Brustkrebs steigt nur leicht durch die Einnahme der Pille. Beobachtungen haben gezeigt, dass Krebserkrankungen des Gebärmutterhalses häufiger vorkommen als ohne Pilleneinnahme. Das Risiko für das Auftreten von bösartigen Tumoren des Dickdarms, der Eierstöcke und der Gebärmutterschleimhaut wird durch die Einnahme der Pille hingegen gesenkt. Insgesamt haben sich keine Hinweise zu Langzeitrisiken für Frauen, die in der Vergangenheit die Pille eingenommen haben, ergeben. Rauchen erhöht das Risiko für Gefäßerkrankungen, der Tabakrauch führt zu einer Verengung der Blutgefäße, unterstützt eine ungünstige Veränderung der Blutfettwerte und verschlechtert die Fließeigenschaften des Blutes. Dadurch erhöht Rauchen die Wahrscheinlichkeit an Herzkreislauferkrankungen oder Thrombosen zu erkranken. Frauen (über 35 Jahre), die mehr als fünfzehn Zigaretten täglich rauchen, sollten daher möglichst ganz auf die Pille verzichten.