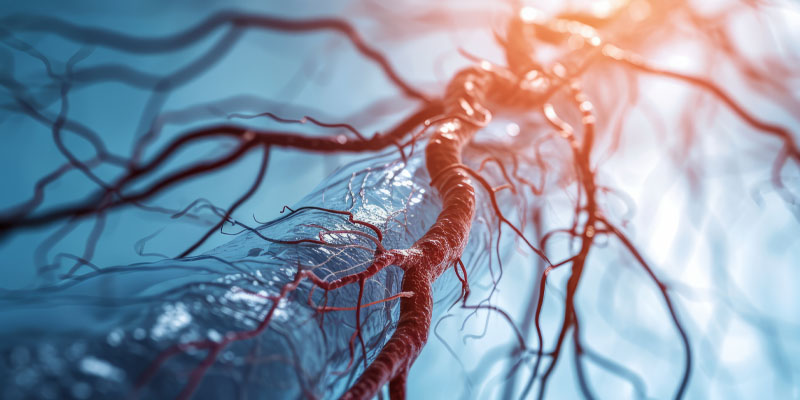Kreatin
Werbebeitrag 1 von 4/ Autor Peter M. Crause
Kreatin
Studie für Studie wird klarer, dass Kreatin weit mehr kann, als nur im Sportbereich positiv zu wirken. Nicht nur in der medizinischen Therapie bei Muskelkrankheiten, sondern insgesamt bei energieintensiven körperlichen Prozessen scheint Kreatin der Schlüssel zu besserer Leistung oder schnellerer Regeneration zu sein. Wir wollen in mehreren Teilen die Funktionen von Kreatin beleuchten. In diesem Monat schauen wir darauf, wie Frauen von einer ausreichenden Aufnahme von Kreatin profitieren können. Aber zuerst lassen Sie uns einen Blick auf die organische Säure Kreatin richten. Kreatin wird zu 50 % vom Körper selbst in der Bauspeicheldrüse, der Leber und der Niere gebildet, den Rest nehmen wir über Fleisch und Fisch mit der Nahrung auf. Kreatin besteht aus den Aminosäuren Glycin, Arginin und Methionin und gilt als Schlüsselsubstanz für den Energietransfer im Körper. Die organische Säure spielt eine zentrale Rolle im Energiestoffwechsel, sie wird vorwiegend in den Muskeln gespeichert und hilft dabei, schnell Energie bereitzustellen. Gänzlich ohne Kreatin würde der gesamte Energiekreislauf im Körper nicht funktionieren. Dabei ist Kreatin ein bekanntes und viel untersuchtes Nahrungsergänzungsmittel, das seit Langem im Bereich des Kraftsports und der Fitness eingesetzt wird. Seit dem Jahr 1998 gilt es als legales Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Und gerade weil es im Sport eine derart hohe Relevanz hat, ist es wohl eines der am besten untersuchten Nahrungsergänzungsmittel. Aber wie funktioniert Kreatin? Um es vereinfacht zu sagen, geht es um die Erhöhung der Wasseraufnahme in den Körperzellen. So können etwa Muskelvolumen und die Muskelmasse erhöht und der Körper gleichzeitig entlastet werden, wenn energieintensive Prozesse ablaufen. Nur: Wenn mehr Wasser eingelagert wird: Gibt es nicht das Risiko „aufzuschwemmen“ oder massiv an Gewicht zuzulegen? Keine Bange, dieser Mythos hält sich zwar hartnäckig, davon wird es er aber nicht richtiger. Fakt ist, dass bei einer Überdosierung von Kreatin die einzige Nebenwirkung Magen-Darm-Probleme sein kann. Normalerweise wird die nicht genutzte Kreatinmenge einfach ausgeschieden. Sprechen wir von zusätzlichem Körpergewicht, dann ist dies sehr individuell. Mehr als ein winziges Kilogramm zusätzlich ist unwahrscheinlich. Insofern also auch Entwarnung für Menschen, die stark auf das eigene Gewicht achten.
Mehr Kraft für Frauen
Auf 80 bis 130 Gramm belaufen sich die Kreatinvorräte erwachsener Menschen. Ein Teil davon wird kontinuierlich verbraucht oder ausgeschieden und muss ersetzt werden, was jeweils etwa zur Hälfte durch die Synthese bestimmter Aminosäuren sowie über die Ernährung geschieht. Als Quellen für Kreatin dienen in der Regel tierische Lebensmittel – insbesondere unverarbeitetes Fleisch und Fisch. Um die tägliche Dosis von etwa drei Gramm aufzunehmen, ist aber beispielsweise circa 600 g rohes Steak oder 700 g Lachsfilet vonnöten. Da die körpereigene Kreatinproduktion wie viele andere Stoffwechselvorgänge auch im Laufe der Zeit nachlässt und reifere Menschen oft weniger essen, droht eine Abwärtsspirale, denn mit niedrigen Kreatinbeständen und abnehmender Muskelmasse schwinden Kraft und Vitalität. In diesem Fall kann die Zugabe von Kreatin außerordentlich sinnvoll sein. Beim prämenstruellen Syndrom (PMS) wird ebenfalls über Kreatin diskutiert; ein renommierter deutscher Produzent unterstützt Studien dazu. Da Muskelkrämpfe und -schmerzen häufige Symptome von PMS sind, könnte Kreatin durch seine Wirkung auf die Muskelenergie und -erholung Linderung verschaffen. Da dazu Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und Depression häufige PMS-Symptome sind, könnte Kreatin durch die Unterstützung der Energieversorgung im Gehirn zur Stimmungsstabilisierung beitragen. Auch das Problem der verringerten Wassereinlagerungen während PMS könnte ein weiterer potenzieller Vorteil sein. Interessant sind die potenziellen Vorteile während der Schwangerschaft: Während der Schwangerschaft ist der Energiebedarf erhöht und Kreatin könnte zur Erhaltung der Energieproduktion beitragen. Weiterhin kann die fetale Gehirnentwicklung durch die ATP-Produktion unterstützt oder während der Geburt einem möglichen Sauerstoffmangel des Fötus vorgebeugt werden. Ähnlich sind auch energiezehrende Prozesse in der Post-Menopause sowie Fruchtbarkeit und Empfängnis im Blick von Forschenden. Verringerter oxidativer Stress für Eizellen und Spermien, Verbesserung der hormonellen Balance – Kreatin ist gerade für Frauen ein spannendes Thema.